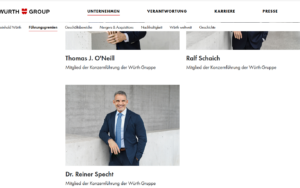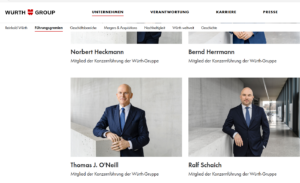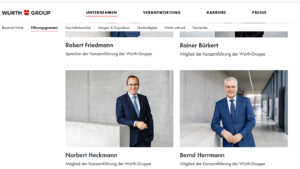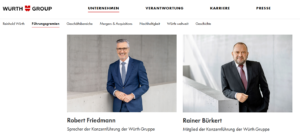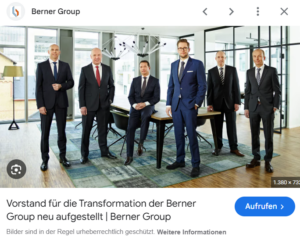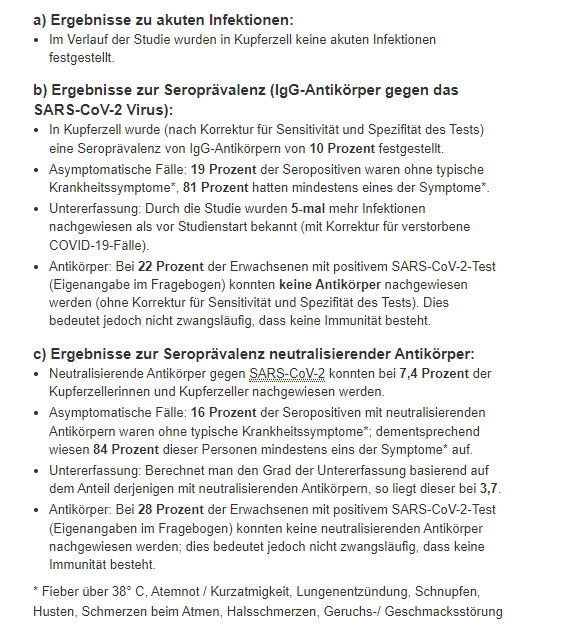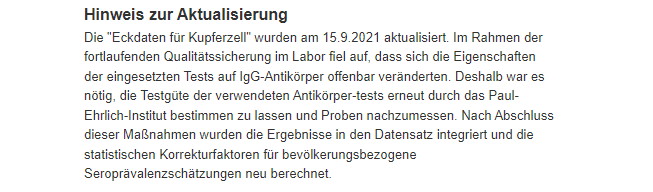„Herr Spieles, das ist kein Spiel“ – steht auf einem Plakat der zirka 70 Bürger:innen, die am Sonntag, den 09. Februar 2025, eine Begehung entlang des Steinbruches in Rüblingen machen. Der Steinbruch liegt idyllisch am Waldrand, Wiesen und Wald so weit das Auge reicht. Doch damit soll bald Schluss sein, wenn es nach den Bürgermeistern der anliegenden Städte und Gemeinden geht.

Flyer der BI zur geplanten Teerverbrennungsanlage.
Am Dienstag, den 11. Februar 2025, berät der Gemeinderat in Kupferzell über die deutschlandweit erste Teerverbrennungsanlage in dieser Form, die direkt neben den Steinbruch kommen soll. Ein 30 Meter hoher Schlot bläst dann fast jeden Tag 24 Stunden extrem viel CO2 in die Luft und möglicherweise auch krebserregende Stoffe.


Liest man die Beratungsvorlage zur Gemeinderatssitzung, so könnte man den Eindruck gewinnen, dass hier schon längst nicht mehr die Frage im Raum steht, OB die Anlage kommt, sondern nur noch, WANN und in welcher Form:
Kupferzell nimmt Stellung
“ In der GR-Sitzung im Oktober 2024 wurde beschlossen, dass zu dem Thema „NovoRock“ eine enge
Zusammenarbeit der Gemeinden Braunsbach und Kupferzell erfolgen soll. Dabei wurde auch eine
gemeinsame Stellungnahme vorgestellt und anschließend in den Mitteilungsblätter veröffentlicht und
an den Personenkreis (Abgeordnete, Regierungspräsidentin, Regionalverband und Landräte)
versendet.
Mit Frau Regierungspräsidentin Bay konnte sich BM Spieles bereits vor Weihnachten in Künzelsau
über das Schreiben, den Sachstand und die Sichtweise über NovoRock austauschen. Es wurde
deutlich, dass auch von Seiten RPS die Klärung über den Standort von besonderer Bedeutung ist.
Hier ist der Vorhabenträger mit dem RPS in einem intensiven Austausch, ob und wenn ja welche
Verfahrensart über die Nennung eines Standortes (z. B. Raumordnungsverfahren) angewendet wird.
Um weiterhin miteinander im Gespräch zu bleiben, fand Ende November 2024 zwischen
Vorhabenträger, Verwaltung und Vertreter der Faktionen ein Treffen statt.
Bei diesem Treffen wurde insbesondere über die Wahl des Standorts und der Weg dorthin diskutiert.
Über den Standort ist, wie oben beschrieben, das RPS mit dem Vorhabenträger im Austausch.“
Das ganze Dokument ist hier einsehbar:
Ratsinformationssystem: Gemeinde Kupferzell
Bürgermeister Spieles von Kupferzell ist bei diesem umwelttechnisch sehr kritischen Vorhaben ähnlich eng im Austausch mit dem Stuttgarter Regierungspräsidium wie vor einigen Jahren beim deutschlandweiten ersten und bislang einzigen XXL-Strom-Booster-Vorhaben, der ebenfalls in Kupferzeller Gemarkung Heimat findet. Ein Zufall? Trotz einer starken Bürgerinitiative (BI) konnte der Booster damals nicht verhindert werden. Auch GSCHWÄZ berichtete kritisch darüber:
Riesenbatterie Archive – GSCHWÄTZ
Nun tut sich die BI bezüglich der Teerverbrennungsanlage ähnlich schwer, an den Entscheidungsprozessen etwas zu verändern. Das frustriert viele Anwohner:innen.
„Ich möchte, dass meine Kinder hier gesund aufwachsen können“, erklärt ein junger Mann seine Beweggründe, warum er an der Begehung teilnimmt. “

Sobald die Anlage läuft, betrifft die schlechtere Luft alle Dörfer, Städte und Gemeinden in einem Radius von rund 10 Kilometer Luftlinie, also auch Künzelsau, Kupferzell, Rüblingen, Steinkirchen, Döttingen, Braunsbach, Kocherstetten, Amrichshausen und viele weitere. Bislang wissen hauptsächlich Bürger:innen von der geplanten Anlage, die unmittelbare in den betroffenen Gemeinden wohnen.

Das Unternehmen NovoRock, welche der Betreiber der Anlage wäre, gibt sich derweil greenwashed gelabelt:
„NovoRock hat eine nachhaltige Lösung entwickelt, um teerhaltigen Straßenaufbruch nach höchsten Umweltstandards zu recyceln und als Recycling-Baustoff wieder in den regionalen Nutzungskreislauf zurück zu bringen. Das Bindemittel wird als Wärmequelle für die Anlage genutzt. Die Anlage arbeitet so im Betrieb ohne zusätzliche Brennstoffe und erzeugt außerdem ihren eigenen Strombedarf. Es bleibt ein nutzbarer Wärmeüberschuss, den wir der Region zur Verfügung stellen werden. Mit diesem Projekt wird der begrenzte Vorrat an Naturbaustoffen und Deponieraum geschont. Der rückgewonnene Stein dient als Ersatz für einen Teil der im Steinbruch Rüblingen erzeugten Naturstein.“
Über den extrem hohen CO2-Ausstoß verliert der Betreiber kein Wort. Wieso Rüblingen?, fragt NovoRock selbst auf seiner Homepage. Als Antwort steht dort unter anderem: „Sie ist von außen nicht einsehbar.“