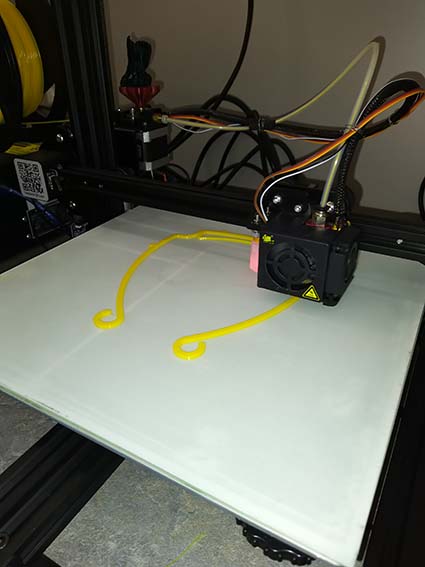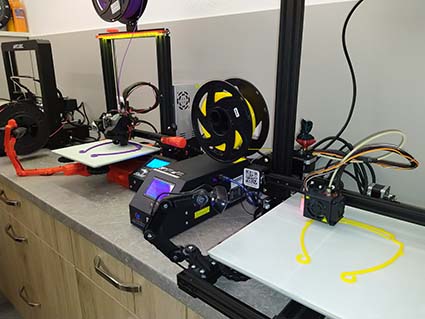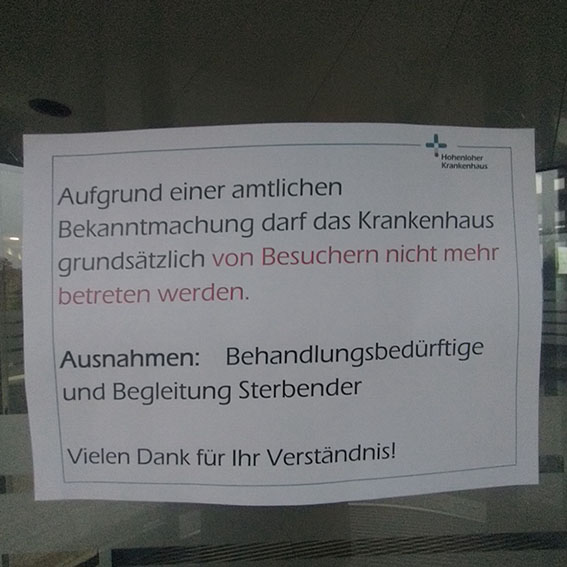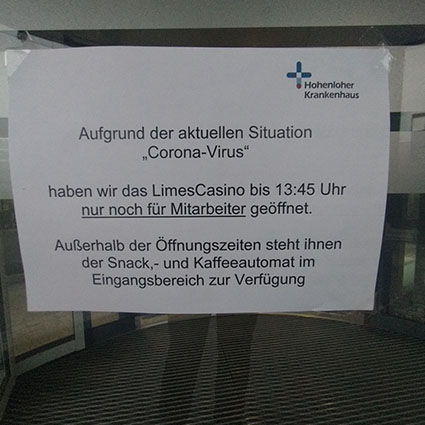„Das Krankenhaus sagte, das Kind sei verwahrlost und müsse aus der Pflegefamilie genommen werden“ – Waldenburger Pflegemutter erhebt schwere Vorwürfe gegen Jugendamt des Hohenlohekreises
„Wir brauchen ein Jugendamt, das genau hinschaut und Familien stärkt und stützt und nicht einfach Kinder rausnimmt“, sagt Barbara Hammer. Die Waldenburgerin erhebt schwere Vorwürfe gegen das Jugendamt in Künzelsau. „Ich habe sechs leibliche Kinder und drei Pflegekinder großgezogen“, sagt sie. Doch obwohl sie rund 25 Jahre zur Zufriedenheit aller mit dem Jugendamt zusammenarbeitete, wurde ihr der jüngste Pflegesohn 2017 weggenommen. Das Jugendamt in Künzelsau äußerte sich auf GSCHWÄTZ-Nachfrage aus Gründen der Schweigepflicht nicht zu dem Fall.
Lauf nach Berlin aus Protest
Die Familie rieb sich in dem Kampf ums Pflegekind auf, der Mann von Barbara Hammer hatte deswegen sogar einen Herzstillstand. Auch ihr selbst habe alles unheimlich zugesetzt. Doch sie kämpft weiter, kann nicht aufgeben. Sie geht auf Demos, schreibt Lieder, die sie auf der Straße singt, verfasst Briefe an Politiker. Im Februar ist sie sogar mit einer Mitstreiterin zu Fuß nach Berlin gelaufen beziehungsweise mit dem Liegerad gefahren. „Der Junge sagt zu mir, Oma hilf mir“, erzählt sie. „Da kann ich ihn doch nicht im Stich lassen.“ Auch wenn es längst nicht mehr nur um den Jungen gehe, sondern um die Sache. „Das Jugendamt behauptet, ich würde nur den Jungen wollen, aber ich habe fünf Enkel, da brauche ich nicht unbedingt noch ein pubertierendes Kind“, erklärt sie.
Pflegeoma bekommt Fürsorge fürs Kind
Der Junge, mittlerweile 14 Jahre alt, ist der Sohn ihrer zweiten Pflegetochter und lebte seit seiner Geburt bei Barbara Hammer. „Die Eltern des Jungen, die auch miteinander verheiratet waren, sind beide behindert“, erzählt die 64-Jährige. Die Mutter sei lernbehindert in Richtung geistig behindert. „Ich würde das aber eher eingeschränkt nennen“, sagt Barbara Hammer. Die Eltern hätten gleich zu Beginn der Schwangerschaft um Hilfe gebeten. Das Jugendamt übertrug der Pflegeoma die Fürsorge für das Kind. Mutter und Sohn lebten bei den Pflegeeltern, der Vater in der gleichen Straße, aber in einem anderen Haus. Der Junge sollte sich zu seiner Pflegefamilie zugehörig fühlen. Die kleine Familie konnte sich jeden Tag sehen, was laut Barbara Hammer „eher zu viel war“. Die Eheleute stritten sich sehr, sie aber wollte ihrer Pflegetochter beibringen, „dass das nicht gut ist“. Doch nach zwei Jahren zog die Mutter zu ihrem Mann, das Kind blieb bei der Oma und durfte seine Eltern jedes zweite Wochenende besuchen. Mittlerweile sind die Eltern geschieden.
Jugendamt als Unterstützung
Barbara Hammer ist keineswegs gegen das Jugendamt. „Wir brauchen ein Jugendamt, das adäquate Hilfe gibt“, sagt sie und plädiert dafür, dass auch leicht behinderte Mütter ihre Kinder behalten dürfen, das Jugendamt nur unterstützend tätig wird. „Diese Mütter müssen die Last erleben, die ein Kind auch mit sich bringt“, erklärt die sechsfache Mutter. Außerdem solle die Hilfe sofort einsetzen, bei Verdacht. Das Ziel sollte nicht die Inobhutnahme der Kinder sein, jedoch sei laut Barbara Hammer jeder 50. Minderjährige fremd untergebracht. Bezahlbarer Wohnraum und ein ausreichender Lohn seien nach ihrer Meinung hier noch die beste Hilfe. Ihre Pflegetochter ist mittlerweile selbstständig und hat eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Besuche einmal im Monat erlaubt
Der Pflegesohn lebt selbst mit einer Einschränkung – „er hat einen IQ von 83“, erklärt die Pflegemutter. Er besuchte die Grundschule in Waldenburg und die Familie versuchte, seine Gehirnentwicklung ohne Nachhilfe aber mittels Klavier- und Tennisspielen anzuregen. „Wenn eine Kind Selbstbewusstsein entwickelt, dann fällt ihm das Lernen leichter“, ist Barbara Hammer überzeugt. Mittlerweile wohnt der Pflegesohn im Diaspora-Haus in Rottenburg/ Neckar. „Das Jugendamt wollte den Jungen so weit weg unterbringen, dass ihn sein leiblicher Vater nicht mehr besuchen kann“, beklagt die Frau. Sie selbst darf den Jungen einmal im Monat begleitet besuchen. Für ihren Mann sind diese Besuche aber zu anstrengend. Seine Mutter darf der Junge besuchen, aber nur wenn die Pflegeoma nicht auch dort ist.
Kind vermisst Pflegefamilie
„Es ist ja kein schlechtes Heim, wo er jetzt lebt“, erklärt Barbara Hammer. „Er sagt, dass es zu 25 Prozent okay dort ist, aber auch, dass er zu 75 bis 80 Prozent zurück zu uns möchte.“ Er vermisse seine Pflegefamilie. Doch seien seither Dinge passiert, die man mit einem Kind nicht mehr aufarbeiten könne. „Eigentlich wollte er immer Busfahrer werden, aber als ihn das letzte Mal eine Lehrerin danach fragte, meinte er, dass er jetzt arbeitsloser Penner werden wolle“, beklagt die Pflegemutter.
Zwei Jahre Kampf
Zwei Jahre kämpften sie und ihr Mann um das Kind. „Uns wurde angekreidet, dass wir ihn mit zur Flüchtlingshilfe nahmen“, erzählt sie. Als der Junge aus der Pflegefamilie genommen wurde, wurde er im Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn untersucht. „Das Krankenhaus sagte, das Kind sei verwahrlost und müsse aus der Pflegefamilie genommen werden“, beklagt Barbara Hammer. „Und das, obwohl uns das Jugendamt 25 Jahre lang bestätigt hatte, dass die Maßnahme geeignet ist.“ Außerdem drehe und wende das Amt alles so, wie es das haben wolle, und reagiere nur schleppend auf Briefe.
„Alles soll Gewinn bringen“
Letztendlich, sagt Barbara Hammer, gehe es nur ums Geld. „Alles soll Gewinn bringen heutzutage“, beklagt sie. Den meisten Gewinn mache am Ende der Investor der jeweiligen Einrichtung. Kinderheime seien hier nicht anders als Pflege- und Altenheime, die ja auch Gewinn machen müssten. „Gut fürs Kind kann man nur mit den Eltern agieren“, sagt sie. „Wenn man ein Kind aus der Familie nimmt, muss man mit den Eltern zusammenarbeiten.“ Deshalb sollte das Jugendamt Begleiter sein. Aber das seien lediglich Bevormunder, klagt sie an. „Die Helfer sind grenzüberschreitend und das darf nicht sein.“ Im sozialen Bereich gebe es viele tolle Prospekte, aber dahinter sehe es anders aus und fast keiner halte sich an die Regeln. Eine Inobhutnahme sollte immer die letzte Option sein. „Aber das wird kaum gemacht“, beklagt Barbara Hammer. „Auch eine schnellstmögliche Rückführung gibt es kaum noch.“ Das habe finanzielle Gründe.
114 Kinder in Hohenlohe außerhalb der Familie untergebracht
Jedoch schreibt Sascha Sprenger vom Landratsamt Künzelsau, bei dem das Jugendamt angegliedert ist, auf GSCHWÄTZ-Nachfrage, dass die Anzahl der Kinder, die im Rahmen der Jugendhilfe fremduntergebracht werden, sich je nach Bundesland sehr stark unterscheide. „Baden-Württemberg ist das Bundesland, das im Vergleich mit allen anderen Bundesländern am wenigsten Kinder im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stationär versorgt“, so Sprenger. Die Quote liege je 1000 der Null- bis unter 21-Jährigen bei 7,6 in Baden-Württemberg. Laut Sprenger waren im Jahr 2019 im Hohenlohekreis insgesamt 114 minderjährige Kinder und Jugendliche außerhalb der eigenen Familie untergebracht, etwa die Hälfte davon in Vollzeitpflege.
Vollzeitpflege ist ein Ehrenamt
„Was die Unterbringung in einer Wohngruppe kostet, hängt davon ab, welche Leistung dort angeboten wird“, schreibt Sprenger weiter. „Die Leistungs- und damit auch die Entgeltunterschiede können sich zwischen 4.500 bis zu 10.000 Euro je Monat bewegen.“ Doch Vollzeitpflege sei ein Ehrenamt und das was Pflegeeltern erhalten würden, setze sich zusammen aus dem Sachaufwand und den Kosten für Pflege und Erziehung und ist nach Alter gestaffelt. Für bis zu Sechsjährige gibt es bis zu 848 Euro, für Sechs- bis Zwölfjährige 933 Euro und für Zwölf- bis 18-Jährige 998 Euro. Sprenger weiter: „Darüber hinaus erhalten Pflegeeltern anteilig Kindergeld für die betreuten Pflegekinder“. Die Pflegegelder werden in der Regel jährlich angepasst. Grundlage sind die Empfehlungen des Deutschen Vereins.
„Es ist zunehmend herausfordernder, Familien zu finden“
Gefragt, ob es genügend Pflegefamilien in Hohenlohe gibt, schreibt Sprenger: „Wie in anderen Ehrenamtsbereichen gestaltet es sich auch im Bereich der Pflegefamilien zunehmend herausfordernder, Familien zu finden, die sich vorstellen können, ein fremdes Kind mit seiner Geschichte bei sich aufzunehmen, es zu fördern und zu erziehen“. Ob aber ein Kind in einer Pflegefamilie oder in einer Wohngruppe untergebracht wird, hänge davon ab, welchen Förderbedarf das Kind hat und davon, in welcher Wohnform diesem Förderbedarf am besten entsprochen werden könne.
Der Link zu Barbara Hammers Facebook-Seite: https://www.facebook.com/barbara.hammer.121
Text: Sonja Bossert

Sie ist auf Demos aktiv. Foto: GSCHWÄTZ

Adäquate Hilfe sieht anders aus, sagt sie. Foto: GSCHWÄTZ

Barbara Hammer. Foto: GSCHWÄTZ

Demo gegen Kindesentzug in Heilbronn. Foto: privat

Barbara Hammer geht auf Demos wie hier in Heilbronn. Foto: privat

Demo gegen Kindesentzug in Heilbronn. Foto: privat

Demo gegen Kindesentzug. Foto: privat